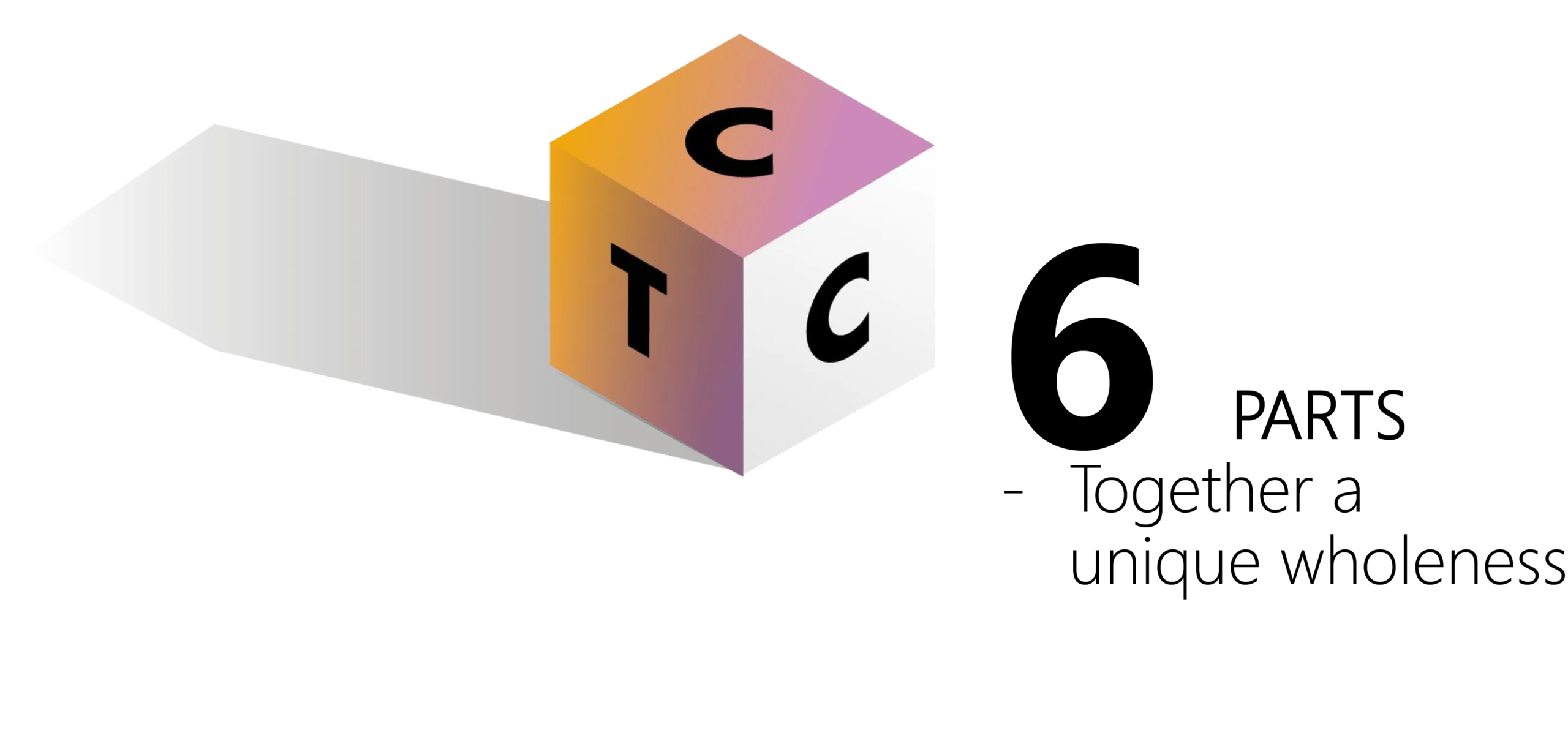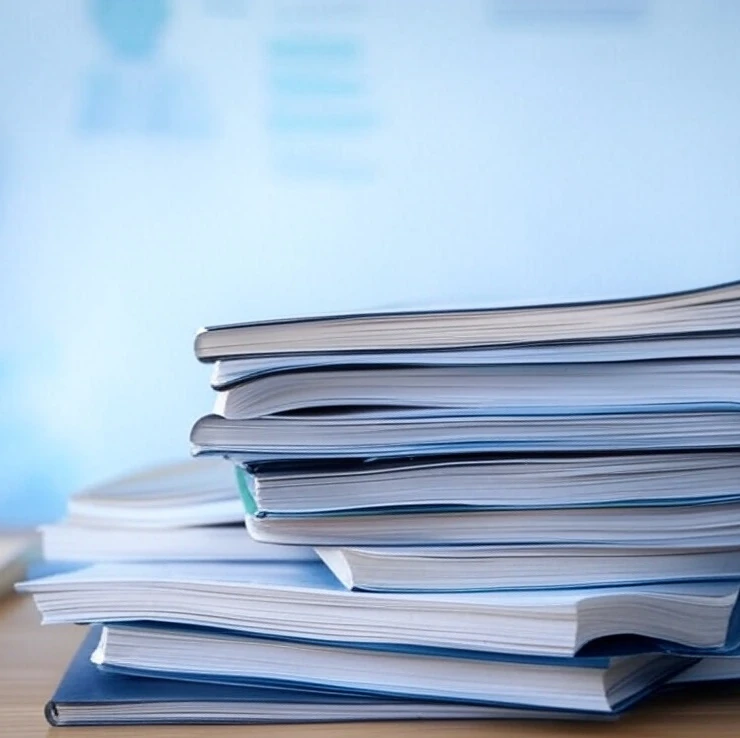1. Einleitung
In den letzten Jahrzehnten hat die Präventionsforschung und -praxis erkannt, dass komplexe Problemlagen nicht durch isolierte Einzelmaßnahmen wirksam gelöst werden können. Stattdessen braucht es umfassende, integrierte Ansätze (Hawkins et al., 2002). Zwei Konzepte, die diesen Anspruch verfolgen, sind „Communities That Care“ (CTC) und die „Präventionskette“. Beide vernetzen auf kommunaler Ebene verschiedene Akteure und Angebote, um Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung zu fördern.
Dieser Artikel vergleicht beide Ansätze hinsichtlich ihrer Grundlagen, Vorgehensweisen und Wirksamkeitsnachweise. Ein besonderer Fokus liegt auf der Frage, inwiefern es sich jeweils um integrierte kommunale Präventionsstrategien handelt. Abschließend werden die spezifischen Vorteile und Herausforderungen beider Ansätze herausgearbeitet.
2. Communities That Care als integrierte kommunale Präventionsstrategie
Communities That Care wurde in den 1980er Jahren von J. David Hawkins und Richard F. Catalano an der University of Washington entwickelt (Hawkins et al., 2002). Das Konzept basiert auf dem Social Development Model, einer integrativen Theorie zur Erklärung prosozialen und problematischen Verhaltens von Kindern und Jugendlichen (Catalano & Hawkins, 1996).
2.1 Theoretische Grundlagen
Das Social Development Model verbindet Erkenntnisse aus der Kontrolltheorie, der sozialen Lerntheorie und der differentiellen Assoziationstheorie. Der Grundgedanke: Kinder und Jugendliche entwickeln dann prosoziales Verhalten, wenn sie:
- Gelegenheiten für sinnvolle Beteiligung in Familie, Schule und Gemeinwesen erhalten
- Die nötigen Fähigkeiten zur Beteiligung besitzen
- Für ihr Engagement Anerkennung erfahren
Dies führt zu einer Bindung an prosoziale Vorbilder und zur Übernahme positiver Normen, was wiederum prosoziales Verhalten fördert. Umgekehrt kann eine Bindung an Personen mit problematischen Verhaltensweisen zur Übernahme entsprechender Muster führen (Catalano & Hawkins, 1996).
Die Soziale Entwicklungsstrategie (SDS) operationalisiert diese theoretischen Erkenntnisse und bildet das Herzstück des CTC-Ansatzes. Sie ist keine isolierte Komponente, sondern durchzieht als Leitprinzip alle Ebenen der CTC-Implementierung. Die SDS bietet einen gemeinsamen Rahmen, der von allen Akteuren der Kommune – von Lehrern über Jugendarbeiter bis zu Eltern – angewendet werden kann, um positive Entwicklung junger Menschen zu fördern.
2.2 Vorgehen
CTC arbeitet mit einem systematischen, datengestützten Ansatz zur kommunalen Prävention (Hawkins et al., 2008):
- Mobilisierung der Gemeinde: Schlüsselpersonen aus Verwaltung, Schulen, Jugendhilfe, Polizei und Gesundheitswesen werden für eine Zusammenarbeit gewonnen.
- Aufbau einer Steuerungsgruppe: Ein Lenkungsausschuss und Arbeitsgruppen werden gebildet.
- Erstellung eines Gemeindeprofils: Durch Schüler-Befragungen und andere Datenquellen werden Problemverhaltensweisen sowie Risiko- und Schutzfaktoren in der Gemeinde erfasst.
- Priorisierung: Anhand der Daten werden Schwerpunkte für die Prävention festgelegt.
- Auswahl evidenzbasierter Programme: Aus einer Datenbank bewährter Präventionsprogramme werden passende Maßnahmen ausgewählt.
- Implementierung und Evaluation: Die Programme werden umgesetzt und ihre Wirksamkeit überprüft.
Dieser Prozess wird in einem Zyklus von etwa 2-5 Jahren wiederholt.
2.3 Integrierter Ansatz
Communities That Care ist eine integrierte kommunale Präventionsstrategie, da sie:
- Verschiedene Akteure und Sektoren (Verwaltung, Bildung, Jugendhilfe, Gesundheit) einbezieht und vernetzt
- Auf unterschiedlichen Ebenen ansetzt (Individuum, Familie, Schule, Gemeinwesen)
- Verschiedene Risiko- und Schutzfaktoren adressiert
- Unterschiedliche Problemverhaltensweisen in den Blick nimmt
- Evidenzbasierte Programme aus verschiedenen Bereichen kombiniert
- Einen langfristigen, systematischen Prozess verfolgt
Die konsequente Anwendung der Sozialen Entwicklungsstrategie (SDS) als Querschnittsthema bedeutet, dass CTC weit mehr als nur die Implementierung evidenzbasierter Programme ist – es handelt sich vielmehr um eine gemeinschaftsweite Veränderungsstrategie. Die SDS-Prinzipien (Schaffung von Möglichkeiten, Entwicklung von Fähigkeiten und Anerkennung) werden in allen Phasen des CTC-Prozesses angewendet: Bei der Mobilisierung der Gemeinde, der Datenerhebung, der Programmauswahl und der Evaluation. Sie dienen als gemeinsame Sprache und Handlungsorientierung für alle Beteiligten – von politischen Entscheidungsträgern über Fachkräfte bis hin zu Eltern und Jugendlichen selbst. CTC schult systematisch alle Akteure in der Anwendung der SDS-Prinzipien, damit diese in sämtlichen Interaktionen mit jungen Menschen zum Tragen kommen, nicht nur in spezifischen Präventionsprogrammen. So entsteht ein koordinierter, gemeinsamer Ansatz zur Förderung einer gesunden Entwicklung in der gesamten Gemeinde.
2.4 Armutssensibilität
CTC basiert auf einem klaren Verständnis struktureller sozialer Ungleichheiten und deren Einfluss auf die Entwicklung von Kindern. Der Ansatz berücksichtigt zwei zentrale Faktoren: Die Position in der Sozialstruktur (sozioökonomischer Status, Alter, Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit) und externe Einschränkungen wie nachbarschaftliche Faktoren oder das Ausmaß sozialer Kontrolle (Haggerty & McCowan, 2018).
CTC erkennt an, dass Kinder aus benachteiligten Verhältnissen stärker von Entwicklungsrisiken betroffen sind. Der Ansatz erhebt systematisch Daten über Risiko- und Schutzfaktoren in verschiedenen sozialen Gruppen. Besonderes Augenmerk liegt auf der Stärkung von Schutzfaktoren, die den negativen Einfluss sozioökonomischer Benachteiligungen abmildern können.
Studien zeigen, dass CTC besonders wirksam in Gemeinschaften mit höheren Armutsraten und größerer ethnischer Vielfalt ist. Gemeinden mit diesen Merkmalen verstärkten die soziale Entwicklungsstrategie stärker als homogenere Gemeinden (Brown et al., 2014).
Die Flexibilität des CTC-Modells ermöglicht die Anpassung an spezifische Herausforderungen jeder Gemeinschaft. Der universelle Ansatz vermeidet Stigmatisierung und erreicht die gesamte Gemeinschaft, während er gezielt strukturelle Risikofaktoren angeht.
2.5 Lebenslaufumfassende Perspektive
CTC betrachtet die Entwicklung von der Geburt bis ins junge Erwachsenenalter. Diese umfassende Sichtweise fördert nachhaltige positive Verhaltensmuster und langfristige Erfolge in der Jugend.
Der Ansatz betont die Bedeutung frühzeitiger Interventionen und wird durch das Social Development Strategy (SDS) Modell gestützt. Die CTC-Maßnahmen decken den Entwicklungsverlauf von der frühen Kindheit bis zum Erwachsenenalter ab und sprechen spezifische Bedarfe und Herausforderungen jeder Lebensphase an.
2.6 Partizipation und Schutzfaktoren
CTC setzt die soziale Entwicklungsstrategie (SDS) durch drei Kernprozesse um:
- Schaffung von Möglichkeiten zur bedeutungsvollen Beteiligung
- Entwicklung von Fähigkeiten zur erfolgreichen Beteiligung
- Anerkennung für prosoziale Beteiligung
Diese Prozesse stärken die Bindung zu Familie, Schule und Gemeinschaft, was die Übernahme gesunder Verhaltensstandards fördert (Haggerty & McCowan, 2018).
Die Beteiligung von Jugendlichen ist ein struktureller Bestandteil des CTC-Ansatzes. Die CTC-Schülerbefragung gibt allen Kindern und Jugendlichen in der Kommune die Chance, zur Datenbasis beizutragen. Dies stärkt das Engagement der Jugendlichen und fördert kritisches Bewusstsein, Aktivismus, Sozialkapital, Identitätsentwicklung und Selbstwertgefühl (Coburn, 2011; Ginwright, Cammarota, & Noguera, 2005).
Schutzfaktoren wie soziale Kompetenz, Selbstwirksamkeit und positive Zukunftsvorstellungen schützen Jugendliche vor Risikoverhalten und stärken ihre Resilienz. Besonders für benachteiligte Jugendliche ist die systematische Stärkung dieser Schutzfaktoren entscheidend. Studien zeigen, dass die Wirkung externer Einschränkungen (wie Armut oder sozialer Status) durch diese sozialen Entwicklungsprozesse abgefedert wird (Catalano et al., 2005).
2.7 Empirische Evidenz zu sozialen Disparitäten und Präventionseffekten
Aktuelle Daten aus einer CTC-Schülerbefragung in einer mittelgroßen deutschen Stadt unterstreichen die Bedeutung sozioökonomischer Faktoren für Entwicklungsrisiken und demonstrieren die Wirksamkeit des CTC-Ansatzes bei der Erfassung sozialer Disparitäten. Die standardisierte Befragung, ein Kernelement des CTC-Prozesses, liefert evidenzbasierte Grundlagen für die Entwicklung differenzierter Präventionsstrategien.
Soziale Disparitäten in Risikoverhalten und psychosozialer Gesundheit
Die Daten zeigen einen deutlichen sozialen Gradienten bei problematischem Verhalten und psychischem Wohlbefinden:
- Jugendliche mit niedrigem sozioökonomischem Status (SES) zeigen deutlich höhere Raten von Gewalthandlungen als Jugendliche mit mittlerem und hohem SES. Auch bei Jugenddelinquenz sind Jugendliche mit niedrigem SES überrepräsentiert.
- Während die Unterschiede beim Alkoholkonsum weniger ausgeprägt sind, zeigt sich beim Nikotinkonsum ein deutliches soziales Gefälle, mit mehr als doppelt so hohen Raten bei Jugendlichen mit niedrigem SES im Vergleich zu jenen mit hohem SES.
- Schulabsenz kommt bei Jugendlichen mit niedrigem SES mehr als doppelt so häufig vor wie bei jenen mit hohem SES.
- Der Anteil der Jugendlichen mit depressiven Symptomen ist bei niedrigem SES deutlich höher als bei hohem SES. Auch die Lebenszufriedenheit unterscheidet sich erheblich zwischen den sozioökonomischen Gruppen.
Verteilung von Risiko- und Schutzfaktoren nach sozioökonomischem Status
Die Daten bestätigen die ungleiche Verteilung von Risiko- und Schutzfaktoren:
- Jugendliche mit niedrigem SES berichten deutlich häufiger über Probleme mit dem Familienmanagement und familiäre Konflikte als jene mit mittlerem oder hohem SES.
- Lernrückstände und schlechte Schulleistungen sind bei Jugendlichen mit niedrigem SES mehr als doppelt so häufig wie bei jenen mit hohem SES.
- Familiärer Zusammenhalt als wichtiger Schutzfaktor ist bei Jugendlichen mit niedrigem SES deutlich seltener vorhanden als bei jenen mit mittlerem oder hohem SES. Ähnliches gilt für familäre Möglichkeiten zur prosozialen Mitwirkung.
Diese Befunde unterstreichen die Bedeutung sozialer Determinanten für Entwicklungsrisiken und die Notwendigkeit, systematisch Schutzfaktoren in benachteiligten Gruppen zu stärken. Universelle Prävention ist besonders für sozioökonomisch benachteiligte Jugendliche relevant, da diese mehr Risikofaktoren und weniger Schutzfaktoren aufweisen.
3. Die Präventionskette als integrierte kommunale Strategie
Das Konzept der Präventionskette wurde in Deutschland entwickelt und wird seit den 2000er Jahren in verschiedenen Kommunen umgesetzt. Es zielt darauf ab, Kinder und Jugendliche von der Geburt bis zum Berufseinstieg lückenlos zu fördern und zu unterstützen.
3.1 Definition und Zielsetzung
Präventionsketten sind integrierte kommunale Gesamtstrategien, die fördernde und unterstützende Angebote zur Gesundheitsförderung und Prävention strategisch und zielorientiert aufeinander abstimmen. Sie verstehen sich als Strukturansatz und sind darauf ausgerichtet, ein umfassendes und tragfähiges Netz von Unterstützung, Beratung und Förderung unter aktiver Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und Familien auf kommunaler Ebene zu entwickeln (Richter-Kornweitz, Holz & Kilian, 2023).
Kommunale Fachämter, Institutionen, Träger sowie Akteurinnen und Akteure verbinden sich in einer ressort- und sektorenübergreifenden Kooperation zu einem lebensphasenorientierten Netzwerk. Sie führen bestehende und neue Strukturelemente zusammen und ermöglichen so abgestimmtes Handeln im Rahmen einer integrierten kommunalen Gesamtstrategie. Dieses Vorhaben ist mittel- bis langfristig anzulegen und nicht als kurzfristiges Projekt konzipiert (Böhme & Reimann, 2018; Holz, 2020).
Ziel ist es, die Teilhabechancen aller jungen Menschen für ein gelingendes Aufwachsen zu fördern – mit umfassenden Chancen auf Bildung, Gesundheit und monetär-materieller sowie sozio-kultureller Teilhabe für alle. Besonderes Augenmerk gilt dabei jungen Menschen in Armutslagen, um den langfristigen Folgen fehlender Teilhabechancen wirksam entgegenzutreten.
Drei zentrale Merkmale kennzeichnen Präventionsketten (Richter-Kornweitz et al., 2022):
- Eine lebensphasen- und lebenslagenorientierte Ausrichtung von der Zeit rund um die Geburt bis zum Berufseinstieg
- Das möglichst lückenlose Ineinandergreifen aller Angebote unter besonderer Berücksichtigung der Übergänge zwischen Altersstufen und Handlungsfeldern
- Die abgestimmte Kooperation und Vernetzung aller relevanten Akteure zur Sicherung gelingender kindlicher Entwicklung
3.2 Theoretische Grundlagen und Leitideen
Präventionsketten knüpfen an zentrale Konzepte der Gesundheitsförderung und der Sozialen Arbeit an. Grundlage sind das Modell der sozialen Determinanten der Gesundheit, die salutogenetische Perspektive, der Ansatz der Lebenslagen und Lebensphasen sowie das Präventionsverständnis zur Bearbeitung sozialer Probleme (Holz & Mitschke, 2018; Holz, 2021).
Weitere wichtige Grundlagen sind:
- Die soziallagenorientierte und kommunal ausgerichtete Gesundheitsförderung
- Die Gemeinwesenarbeit mit ihrem Bezug zum Sozialraum
- Die lebensweltorientierte Soziale Arbeit mit ihren Konzepten zur interdisziplinären Kooperation
- Der Leitgedanke der gemeinsamen öffentlichen Verantwortung für ein gelingendes Aufwachsen junger Menschen
Neuere Entwicklungen betonen Armutssensibilität als Leitidee, was bedeutet, die vorhandene Infrastruktur bedarfs- und bedürfnisgerecht weiterzuentwickeln, Leistungssysteme besser zu verzahnen und Zugangshürden abzubauen (Holz, 2021).
3.3 Handlungsprinzipien
Die Arbeit in Präventionsketten folgt mehreren Handlungsprinzipien, die einen wichtigen Orientierungsrahmen bieten:
- Die Lebenslagenorientierung stellt die Bedürfnisse der jungen Menschen in den Mittelpunkt. Angebote unterstützen den individuellen Entwicklungsprozess und orientieren sich an der Leitfrage: „Was brauchen Kinder und Jugendliche?“
- Mit Lebenslauforientierung ist die kontinuierliche Begleitung von der Schwangerschaft bis zum Berufseinstieg gemeint. Dies sorgt für verlässliche Unterstützung in allen Entwicklungsphasen.
- Lebensweltorientierung bedeutet, dass die Maßnahmen im direkten Lebensumfeld der Zielgruppen ansetzen. Die Arbeit erfolgt wohnortnah, niedrigschwellig und berücksichtigt die lokale Sozialstruktur.
- Die Partizipation ermöglicht Kindern, Jugendlichen und Eltern, ihre Perspektiven einzubringen und bei der Gestaltung von Angeboten mitzuwirken. Auch Fachkräfte beteiligen sich aktiv an der Entwicklung.
- Der Praxisbezug stellt sicher, dass alltägliche Settings wie Familie, Kita, Schule und Nachbarschaft einbezogen werden. Die Angebote sind nach Altersphasen (0-3 Jahre, 3-6 Jahre, 6-12 Jahre usw.) strukturiert.
- Die Netzwerkorientierung verbindet relevante Akteure interdisziplinär und fachübergreifend. Bestehende Teilnetzwerke werden zu einer Gesamtstrategie zusammengeführt.
3.4 Vorgehen
Der Aufbau einer Präventionskette verläuft in der Regel wie folgt (Richter-Kornweitz & Utermark, 2013):
- Politischer Beschluss zur Einführung einer Präventionskette, nach Beratung in den kommunalen Ausschüssen
- Einrichtung einer Koordinierungsstelle mit klarem Mandat und struktureller Verankerung
- Aufbau einer Steuerungsgruppe mit relevanten Akteuren aus verschiedenen Ressorts
- Bestandsaufnahme vorhandener Angebote und Ermittlung von Bedarfen und Bedürfnissen
- Identifikation von Lücken und gemeinsame Entwicklung neuer, bedarfsgerechter Angebote
- Vernetzung der Angebote entlang der Altersphasen mit besonderem Fokus auf Übergänge
- Sicherung von Übergängen zwischen Lebensphasen und Institutionen
- Kontinuierliche Weiterentwicklung und wirkungsorientierte Steuerung
Der Prozess ist als langfristiger Qualitätsentwicklungsprozess angelegt und folgt im Wesentlichen den Phasen des Public Health Action Cycle. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Sicherung einer vertrauensvollen, ressortübergreifenden Zusammenarbeit zwischen Akteuren mit unterschiedlichen Handlungslogiken und Ressourcen.
3.5 Wirkungsorientierung und Qualitätsmerkmale
Der Aufbau von Präventionsketten wird als zirkulärer Qualitätsentwicklungsprozess verstanden. Die Steuerung, Planung und Reflexion kann durch eine dialogisch ausgerichtete Wirkungsorientierung unterstützt werden. Dabei werden gemeinsam mit allen Beteiligten Ziele definiert und Indikatoren festgelegt, anhand derer der Prozess beobachtet und angepasst werden kann.
Zentrale Qualitätsmerkmale von Präventionsketten sind:
- Die langfristige strategische Ausrichtung (kein Projektcharakter)
- Die kontinuierliche, hauptamtliche Koordination mit klarem Mandat
- Die politische Legitimation und Unterstützung
- Die ressort- und sektorenübergreifende Zusammenarbeit
- Die partizipative Einbindung aller relevanten Akteure
- Der Fokus auf strukturelle Veränderungen vor der Entwicklung neuer Einzelangebote
Die Wirkungen konzentrieren sich zunächst auf die strukturelle Ebene: Stärkung integrierter Handlungsansätze, Optimierung von Angeboten und Entwicklung zusätzlicher Kompetenzen bei Fachkräften. Darauf aufbauend werden Wirkungen auf der Ebene der Kinder, Jugendlichen und Familien angestrebt.
4. Vergleich der beiden Ansätze
Communities That Care und Präventionsketten weisen als integrierte kommunale Strategien viele Gemeinsamkeiten auf. Beide verfolgen einen umfassenden, sektorenübergreifenden Ansatz zur Förderung des gesunden Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen. Sie setzen auf Vernetzung und Kooperation verschiedener Akteure und zielen auf eine langfristige Verankerung von Prävention in kommunalen Strukturen ab.
Es gibt jedoch auch einige Unterschiede:
4.1 Theoretische Fundierung
Communities That Care basiert auf einer spezifischen, empirisch fundierten Theorie (Social Development Model). Die Präventionskette integriert verschiedene theoretische Ansätze aus Gesundheitsförderung, Pädagogik und Sozialarbeit, ohne sich auf ein bestimmtes Modell festzulegen.
4.2 Datennutzung
Communities That Care setzt stark auf die systematische Erhebung und Nutzung von Daten zur Bedarfsermittlung und Evaluation. Dabei kommen validierte Messinstrumente zum Einsatz. Die erfassten Risiko- und Schutzfaktoren haben einen hohen Vorhersagewert. Bei Präventionsketten wird Datennutzung ebenfalls betont, jedoch mit stärkerem Fokus auf qualitative und kontextbezogene Informationen in Ergänzung zu statistischen Kennzahlen.
4.3 Programmauswahl
Communities That Care greift auf eine Datenbank evidenzbasierter Programme zurück, in Deutschland bekannt als „Grüne Liste Prävention“. Bei Präventionsketten liegt der Schwerpunkt auf der Vernetzung und Optimierung bestehender lokaler Angebote und Strukturen, ergänzt durch die bedarfsgerechte Entwicklung neuer Angebote.
4.4 Evaluation
Die Wirksamkeit von Communities That Care wurde in mehreren randomisierten Studien nachgewiesen. Für Präventionsketten gibt es wachsende Erfahrungswerte und Evaluationskonzepte, die stärker auf strukturelle Veränderungen und qualitative Wirkungen fokussieren.
4.5 Armutssensibilität und Lebenslaufperspektive
Beide Ansätze betonen Armutssensibilität und eine lebenslaufumfassende Perspektive. CTC operationalisiert dies über die systematische Erfassung und Adressierung von Risiko- und Schutzfaktoren. Präventionsketten fokussieren besonders auf die Gestaltung von Übergängen zwischen Lebensphasen und haben einen expliziten Teilhabefokus.
4.6 Partizipation und Familieneinbindung
Beide Ansätze betonen die Bedeutung von Partizipation. CTC nutzt die Schülerbefragung als standardisiertes Instrument und setzt auf spezifische Programme zur Förderung elterlicher Kompetenzen. Präventionsketten integrieren Partizipation als durchgängiges Handlungsprinzip und betonen die aktive Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und Familien bei der Angebotsentwicklung.
5. Spezifische Vorteile und Herausforderungen
5.1 Vorteile von Communities That Care
- Die wissenschaftliche Fundierung durch das Social Development Model und dessen empirische Absicherung erleichtert eine zielgerichtete Umsetzung. Das Modell erklärt zwischen 8% und 49% der Varianz in verschiedenen Outcome-Variablen (Haggerty & McCowan, 2018).
- Das strukturierte Vorgehen bietet Kommunen eine klare Orientierung mit definierten Phasen und Handlungsschritten, was die Implementierung erleichtert.
- Der datengestützte Ansatz ermöglicht eine sozialstrukturell informierte, bedarfsorientierte Planung und Evaluation. Aktuelle empirische Daten bestätigen die Relevanz dieser Methodik.
- Die evidenzbasierte Programmauswahl erhöht die Wirksamkeit und Implementierungsqualität durch den Rückgriff auf Programme mit nachgewiesener Wirksamkeit.
- Die gezielte Ausrichtung auf spezifische Risiko- und Schutzfaktoren ermöglicht effektiven Ressourceneinsatz, besonders angesichts der ungleichen Verteilung dieser Faktoren nach sozioökonomischem Status.
- Die nachgewiesene Wirksamkeit bei Reduktion gesundheitlicher Ungleichheiten zeigt sich in randomisierten Studien mit besonders starken Effekten für benachteiligte Gruppen. CTC-Implementierung reduzierte den Einstieg in Delinquenz um 25%, Gewalt um 15%, Alkoholkonsum um 33% und Tabakkonsum um 32% (Hawkins et al., 2014). Eine Kosten-Nutzen-Evaluation ergab, dass für jeden investierten Dollar eine Ersparnis von 12,88 Dollar erzielt wird (Kuklinski, 2021).
- Die systematische Adressierung struktureller Ungleichheiten berücksichtigt explizit die Position in der Sozialstruktur und externe Einschränkungen als Einflussfaktoren, was besonders relevant ist angesichts der höheren Problemraten bei Jugendlichen mit niedrigem sozioökonomischem Status.
- Die partizipative Ausrichtung fördert die aktive Beteiligung von Jugendlichen an Gemeinschaftsprozessen und stärkt deren Identifikation mit der Gemeinschaft.
- Die Soziale Entwicklungsstrategie als durchgängiges Handlungsprinzip vermittelt allen Akteuren in der Kommune ein gemeinsames Verständnis für die Förderung junger Menschen. CTC ist nicht auf die reine Implementierung einzelner Programme beschränkt, sondern schafft eine gemeinschaftsweite Kultur der Prävention. Die SDS-Prinzipien werden in alle Bereiche des kommunalen Lebens integriert, von Schulen über Jugendeinrichtungen bis hin zur Stadtplanung. Dies schafft einen konsistenten Entwicklungsrahmen für alle Kinder und Jugendliche und stärkt nachhaltig die Präventionskapazität der gesamten Gemeinde.
5.2 Vorteile von Präventionsketten
- Die Flexibilität und lokale Anpassungsfähigkeit ermöglicht ein schrittweises Vorgehen und die Anknüpfung an bestehende Strukturen unter Berücksichtigung der spezifischen kommunalen Bedingungen und Ressourcen.
- Der ausgeprägte Fokus auf Übergänge zwischen Lebensphasen und Institutionen sorgt für kontinuierliche Unterstützung und verhindert, dass Kinder und Familien an diesen kritischen Punkten verloren gehen.
- Der breite Teilhabebegriff betont neben Gesundheit auch Bildung auch materielle und soziokulturelle Teilhabe.
- Die strukturelle Verankerung zielt auf langfristige Veränderungen in kommunalen Strukturen statt auf befristete Projekte. Hauptamtliche Koordinationsstellen und politische Legitimation schaffen nachhaltige Rahmenbedingungen.
- Die ressort- und sektorenübergreifende Zusammenarbeit vernetzt systematisch Akteure aus unterschiedlichen Handlungsfeldern, schafft Synergien und vermeidet Doppelstrukturen.
- Die Integration bestehender Netzwerke führt vorhandene Teilnetzwerke zu einer Gesamtstrategie zusammen, ohne Parallelstrukturen aufzubauen.
- Die Wirkungsorientierung im Kollektiv betont, dass Wirkungen erst durch das Zusammenspiel vieler Aktivitäten und Akteure entstehen. Dies fördert gemeinsame Verantwortung und kontinuierliche Anpassung.
5.3 Gemeinsame Herausforderungen
- Die Sicherstellung langfristiger politischer und finanzieller Unterstützung erfordert Engagement über Legislaturperioden hinaus und kontinuierliche Ressourcen.
- Die Überwindung von Ressort- und Sektorengrenzen stellt hohe Anforderungen an Koordination und Kommunikation zwischen Akteuren mit unterschiedlichen Handlungslogiken und Zielen.
- Die Entwicklung einer gemeinsamen Handlungsorientierung trotz unterschiedlicher Fachlogiken und Interessen ist anspruchsvoll, aber entscheidend für den Erfolg.
- Die kontinuierliche Anpassung an veränderte Bedarfe und Rahmenbedingungen erfordert Flexibilität und Innovationsbereitschaft aller Beteiligten.
- Eine wirkungsvolle Koordination und Steuerung ist notwendig, um die Komplexität der Netzwerke zu managen und klare Strukturen zu schaffen.
- Der Nachweis der Wirksamkeit auf kommunaler Ebene ist methodisch anspruchsvoll und erfordert innovative Evaluationskonzepte für langfristige Effekte.
- Die kontinuierliche Einbindung aller relevanten Akteure über lange Zeiträume stellt eine zentrale Herausforderung dar und erfordert aktives Engagement-Management.
- Die Balance zwischen Standardisierung und lokaler Anpassung zu finden ist ein fortlaufender Prozess, der sowohl klare Strukturen als auch Raum für lokale Besonderheiten erfordert.
6. Diskussion und Schlussfolgerungen
Sowohl Communities That Care als auch Präventionsketten bieten vielversprechende Ansätze für integrierte kommunale Präventionsstrategien. Beide zielen darauf ab, verschiedene Akteure zu vernetzen und junge Menschen ganzheitlich zu fördern.
Communities That Care zeichnet sich durch wissenschaftliche Fundierung, strukturiertes Vorgehen und einen datengestützten Ansatz aus. Dies ermöglicht eine zielgenaue, bedarfsorientierte und wirkungsvolle Umsetzung. Die nachgewiesene Wirksamkeit macht CTC zu einer attraktiven Option für Kommunen, die evidenzbasiert vorgehen möchten.
Die Präventionskette überzeugt durch Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und ihren starken Fokus auf Strukturveränderungen und Übergänge. Sie ermöglicht ein schrittweises Vorgehen und die Anknüpfung an bestehende Netzwerke. Der lebensverlaufsbezogene Ansatz und die durchgängige Betonung von Partizipation sind weitere Stärken.
Für die Weiterentwicklung kommunaler Präventionsstrategien wäre eine Synthese beider Ansätze vielversprechend. Das zuvor genannte Fallbeispiel aus einer mittelgroßen deutschen Stadt zeigt den engen Zusammenhang zwischen sozioökonomischem Status, Risiko- und Schutzfaktoren sowie Problemverhalten und psychischer Gesundheit. Eine Synthese könnte folgende Elemente umfassen:
- Eine stärkere Datenorientierung in Präventionsketten mit systematischer Analyse sozialer Disparitäten, ohne die Flexibilität des Ansatzes einzuschränken
- Die Integration des breiten Teilhabebegriffs in Communities That Care, aufbauend auf der bereits vorhandenen Berücksichtigung der Position in der Sozialstruktur
- Einen gemeinsamen Evaluationsrahmen, der standardisierte und kontextspezifische Indikatoren verbindet und die Wirkungen nach sozioökonomischem Status, Geschlecht und ethnischer Zugehörigkeit differenziert betrachtet
- Eine verstärkte Betonung der Partizipation aller Zielgruppen in beiden Ansätzen, besonders der benachteiligten Gruppen, die von Beteiligungsmöglichkeiten besonders profitieren können
- Den Ausbau der lebenslaufumfassenden Perspektive im Sinne der Nationalen Präventionsziele, wobei frühe Interventionen besondere Bedeutung haben, da soziale Disparitäten bereits im Jugendalter deutlich ausgeprägt sind
- Eine differenzierte Implementierungsstrategie, die universelle Prävention mit gezielten Komponenten für benachteiligte Gruppen kombiniert, da diese mehr Risikofaktoren und weniger Schutzfaktoren aufweisen
Für eine erfolgreiche Umsetzung sind förderliche Rahmenbedingungen nötig: ausreichende Ressourcen, politische Unterstützung und geeignete Governancestrukturen. Die Erfahrungen aus beiden Ansätzen zeigen, dass hauptamtliche Koordination, politische Mandate und die Einbindung aller relevanten Akteure entscheidend sind.
Weitere Forschung sollte langfristige Wirkungen und Erfolgsfaktoren integrierter kommunaler Präventionsstrategien untersuchen. Wichtig ist auch die Analyse von Implementierungsprozessen in verschiedenen kommunalen Kontexten.
Letztlich geht es darum, Kommunen beim Aufbau nachhaltiger Strukturen für wirksame Prävention und Gesundheitsförderung zu unterstützen. Integrierte Ansätze wie Communities That Care und Präventionsketten bieten dafür eine vielversprechende Grundlage. Ihr Potenzial sollte durch kontinuierliche Weiterentwicklung und Anpassung an lokale Bedingungen bestmöglich ausgeschöpft werden, um allen Kindern und Jugendlichen faire Chancen auf ein gesundes und gelingendes Aufwachsen zu ermöglichen.
7. Literatur
Böhme, C. & Reimann, B. (2018). Integrierte Strategien kommunaler Gesundheitsförderung. Rahmenbedingungen, Steuerung und Kooperation – Ergebnisse einer Akteursbefragung. Berlin: Deutsches Institut für Urbanistik gGmbH. https://backend.repository.difu.de/server/api/core/bitstreams/17683059-e8cf-4297-85e0-89783352ca4c/content
Brown, E. C., Hawkins, J. D., Rhew, I. C., Shapiro, V. B., Abbott, R. D., Oesterle, S., … Catalano, R. F. (2014). Prevention system mediation of Communities That Care effects on youth outcomes. Prevention Science, 15, 623-632. doi:10.1007/s11121-013-0413-7
Catalano, R. F., & Hawkins, J. D. (1996). The social development model: A theory of antisocial behavior. In J. D. Hawkins (Ed.), Delinquency and crime: Current theories (pp. 149-197). Cambridge University Press.
Catalano, R. F., Park, J., Harachi, T. W., Haggerty, K. P., Abbott, R. D., & Hawkins, J. D. (2005). Mediating the effects of poverty, gender, individual characteristics, and external constraints on antisocial behavior: A test of the social development model and implications for developmental life-course theory. In D. P. Farrington (Ed.), Advances in criminological theory: Vol. 14. Integrated developmental and life-course theories of offending (pp. 93-123). New Brunswick, NJ: Transaction
Coburn, A. (2011). Building social and cultural capital through learning about equality in youth work. Journal of Youth Studies, 14, 475-491. http://dx.doi.org/10.1080/13676261.2010.538041
Ginwright, S., Cammarota, J., & Noguera, P. (2005). Youth, social justice, and communities: Toward a theory of urban youth policy. Social Justice, 32, 24-40.
Haggerty, K. P., & McCowan, K. J. (2018). Using the social development strategy to unleash the power of prevention. Journal of the Society for Social Work and Research, 9(4), 741-763.
Hawkins, J. D., Catalano, R. F., & Arthur, M. W. (2002). Promoting science-based prevention in communities. Addictive Behaviors, 27(6), 951-976. https://doi.org/10.1016/S0306-4603(02)00298-8
Hawkins, J. D., Brown, E. C., Oesterle, S., Arthur, M. W., Abbott, R. D., & Catalano, R. F. (2008). Early effects of Communities That Care on targeted risks and initiation of delinquent behavior and substance use. Journal of Adolescent Health, 43(1), 15-22. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2008.01.022
Hawkins, J. D., Oesterle, S., Brown, E. C., Abbott, R. D., & Catalano, R. F. (2014). Youth problem behaviors 8 years after implementing the Communities That Care prevention system: A community-randomized trial. JAMA Pediatrics, 168, 122-129. http://dx.doi.org/10.1001/jamapediatrics.2013.4009
Holz, G. (2020). Präventionsketten – Kind-/Jugendbezogene Armutsprävention auf kommunaler Ebene. In: P. Rahn & K.-A. Chassé (Hrsg.) (2020). Handbuch Kinderarmut (S. 302−310). Opladen & Toronto: Verlag Barbara Budrich.
Holz, G, (2021). Stärkung von Armutssensibilität. Ein Basiselement individueller und struktureller Armutsprävention für junge Menschen. Berlin.
Holz, G. & Mitschke, C. (2018). Kommunale Prävention als Fachkonzept und Gesamtstrategie für eine kindorientierte Armutsprävention. In G. Holz, A. Richter-Kornweitz, & C. Wüstendörfer (Hrsg.), Armut und Gesundheit von Kindern und Jugendlichen (S. 283-302). Beltz Juventa.
Holz, G. & Richter-Kornweitz, A. (Hrsg.) (2010). Kinderarmut und ihre Folgen. Wie kann Prävention gelingen? München: Ernst Reinhardt Verlag.
Kuklinski, M. R., Oesterle, S., Briney, J. S., Hawkins, J. D., Catalano, R. F., & Fagan, A. A. (2021). Long-term impacts and benefit-cost analysis of the Communities That Care prevention system at age 23, 12 years after baseline. Prevention Science, 22(4), 452-463. https://doi.org/10.1007/s11121-021-01218-7
Richter-Kornweitz, A., & Utermark, K. (2013). Werkbuch Präventionskette: Herausforderungen und Chancen beim Aufbau von Präventionsketten in Kommunen. BZgA. https://shop.bzga.de/werkbuch-praeventionskette-61411100/
Richter-Kornweitz, A., Holz, G. & Kilian, A. (2023). Präventionskette – Integrierte kommunale Gesamtstrategie zur Gesundheitsförderung und Prävention. In: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) (Hrsg.). Leitbegriffe der Gesundheitsförderung und Prävention. Glossar zu Konzepten, Strategien und Methoden. https://doi.org/10.17623/BZGA:Q4-i093-2.0
Richter-Kornweitz, A., Schluck, S., Petras, K., Humrich, W. & Kruse, C. (2022). Präventionsketten konkret! Ein kompetenzorientiertes Handbuch zur Koordination von integrierten kommunalen Strategien. Hannover: Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen e.V.
Washington State Institute for Public Policy. (2017, May). Benefit-cost results. Retrieved from http://www.wsipp.wa.gov/BenefitCost
Das könnte Sie auch interessieren…