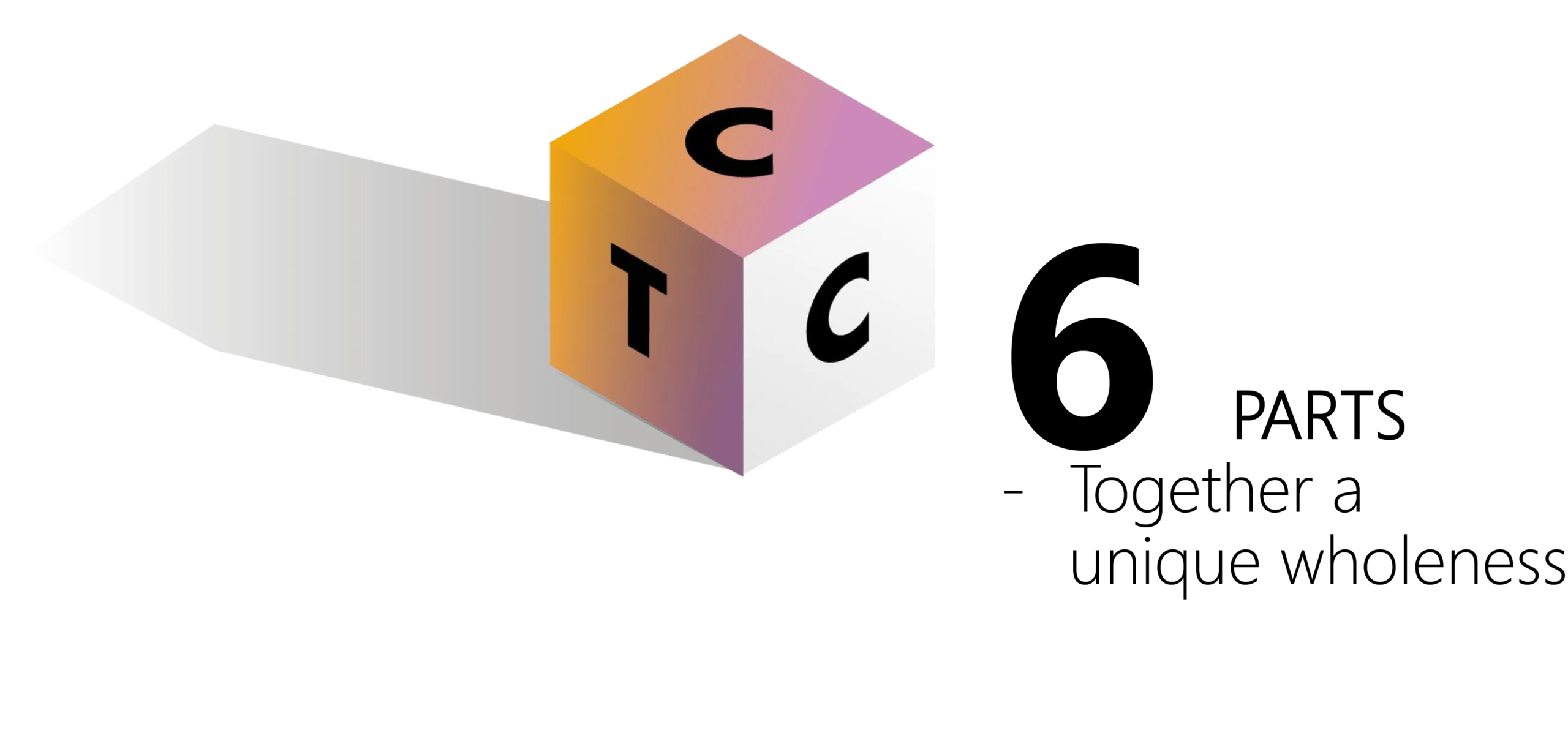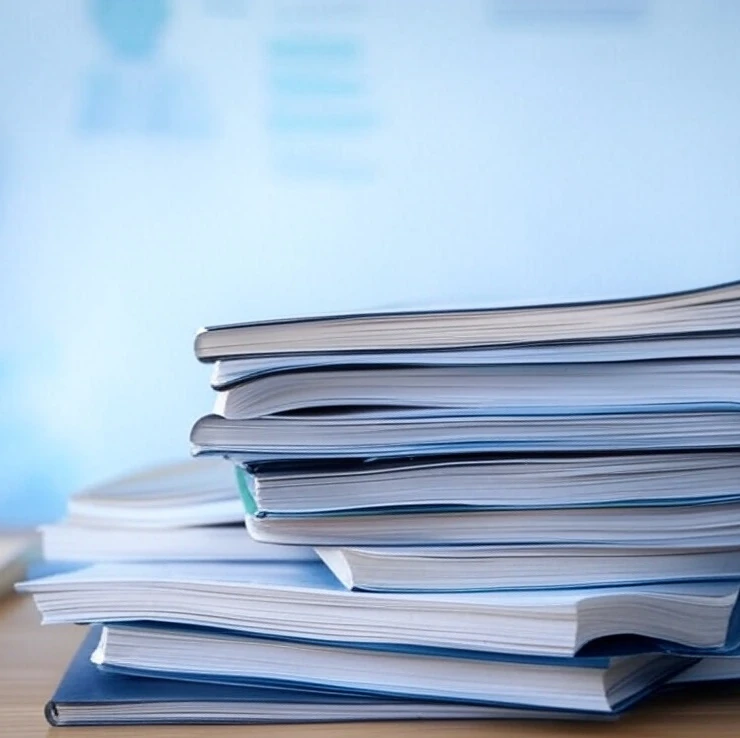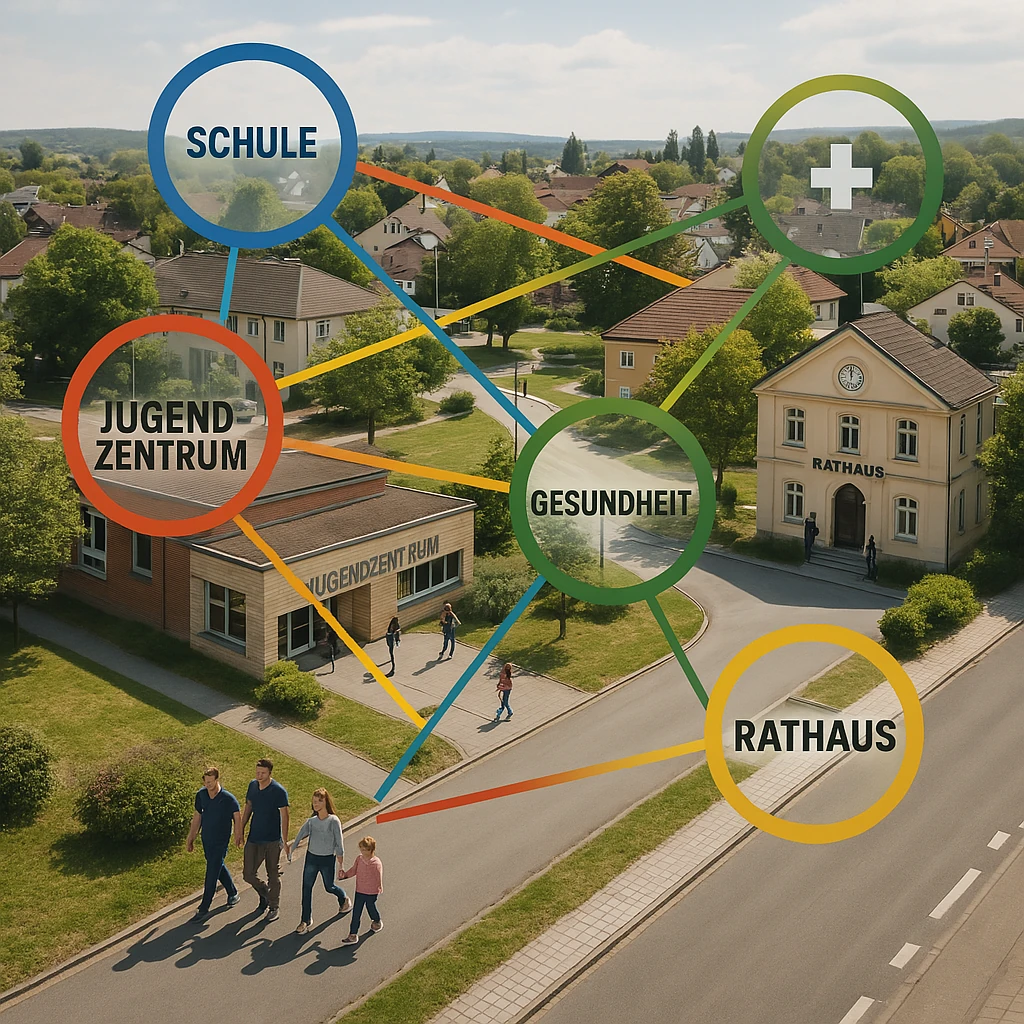- Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Implementation
- Wissenschaftliche Grundlage: Was die Forschung zeigt
- Die 8 Schlüsselfaktoren im Überblick
- Die drei wichtigsten Faktoren im Detail
- Ausreichende Ressourcen für die CTC-Koordination
- Breite Partizipation am lokalen CTC-Prozess
- Effektive Kommunikation im CTC-Gebietsteam
- Priorisierungshilfe: Womit beginnen?
- Selbstcheck für Kommunen: Wo stehen wir?
- Fazit: Der Blick nach vorn
Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Implementation
Die Einführung von Communities That Care (CTC) verspricht Kommunen eine wirkungsvolle Methode zur Prävention von Substanzkonsum, Gewalt und weiteren Problemverhalten bei Heranwachsenden. Doch wie bei vielen wissenschaftlich fundierten Ansätzen liegt die wahre Herausforderung nicht im „Was“, sondern im „Wie“: Während die Prinzipien von CTC klar definiert sind, entscheidet die Qualität der Umsetzung über den tatsächlichen Erfolg in der Praxis.
Jüngste Forschungsergebnisse der CTC-EFF-Studie haben gezeigt, dass die Implementationsqualität direkt mit messbaren Verbesserungen in der kommunalen Präventionsarbeit zusammenhängt (Röding et al., 2025). Kommunen, die CTC hochwertig umsetzen, berichten von stärkerer intersektoraler Zusammenarbeit, besserem Zugang zu Fördermitteln und letztlich auch geringeren Raten an Substanzkonsum bei Jugendlichen (Birgel et al., 2023b).
Dieser Beitrag stellt Ihnen die acht entscheidenden Schlüsselfaktoren vor, die über Erfolg oder Misserfolg Ihrer CTC-Implementation entscheiden können – praxisnah aufbereitet und mit konkreten Handlungsempfehlungen für Ihre tägliche Arbeit.
Wissenschaftliche Grundlage: Was die Forschung zeigt
Die umfangreiche CTC-EFF-Studie hat zwischen 2021 und 2023 in Deutschland untersucht, welche Faktoren den Erfolg von CTC maßgeblich beeinflussen. Diese bundesweite Untersuchung mit 38 CTC-Kommunen und Vergleichskommunen hat erstmals fundierte Daten zur Wirksamkeit und Implementationsqualität von CTC im deutschen Kontext geliefert (Röding et al., 2023).
Die Ergebnisse sind eindeutig: Die Wahrscheinlichkeit für eine wissenschaftsbasierte Umsetzung von Prävention steigt durch eine koordinierte Zusammenarbeit um das 26-fache und durch bedarfsgerechte Planung um das 20-fache (Birgel et al., 2023a). Besonders bemerkenswert: In Kommunen mit hoher Community Capacity für Prävention (definiert als lokales Leistungsvermögen für Prävention) ist das Risiko für Alkoholkonsum bei Jugendlichen um das 3,5-fache reduziert (Birgel et al., 2023b).
Die Forschungsergebnisse zeigen fünf zentrale Faktoren mit besonders großem Einfluss auf die Implementationsqualität von CTC:
- Geringere Barrieren in der kommunalen Zusammenarbeit
- Stärkere Unterstützung durch lokale „Champions“ (Schlüsselpersonen)
- Höhere Community Readiness (Bereitschaft der Kommune)
- Gute externe Unterstützung durch die CTC-Transferstellen
- Ausreichender Stellenumfang für die CTC-Koordination
Die 8 Schlüsselfaktoren im Überblick
Basierend auf der aktuellen Forschung und praktischen Erfahrungen aus der CTC-Arbeit lassen sich acht zentrale Erfolgsfaktoren identifizieren:
| Schlüsselfaktor | Beschreibung | Bedeutung für die Implementation |
|---|---|---|
| 1. Ausreichende Ressourcen für die CTC-Koordination | Mindestens ein halber Stellenanteil für die Koordinationsaufgaben | Grundvoraussetzung für effektive Netzwerkarbeit und Prozesssteuerung |
| 2. Effektive Kommunikation im CTC-Gebietsteam | Regelmäßiger, strukturierter Austausch zwischen allen Beteiligten | Verhindert Konflikte und sichert Informationsfluss und Motivation |
| 3. Systematische Integration neuer Teammitglieder | Klare Prozesse für die Einarbeitung und Beteiligung neuer CTC-Akteure | Gewährleistet Kontinuität und Wissenstransfer bei Personalwechseln |
| 4. Bedarfsgerechte Unterstützung durch CTC-Transferstellen | Gezielte Schulungen und Beratung zu spezifischen Herausforderungen | Externe Expertise hilft, typische Fehler zu vermeiden |
| 5. Positive Haltung und Motivation der Beteiligten | Verdeutlichung der persönlichen und kommunalen Vorteile von CTC | Sichert langfristiges Engagement im Prozess |
| 6. Fundiertes CTC-spezifisches Präventionswissen | Tiefgreifendes Verständnis der theoretischen Grundlagen | Verbessert die Qualität der Präventionsstrategie |
| 7. Wirksame Öffentlichkeitsarbeit | Strategische Kommunikation nach außen | Erhöht Bekanntheit, Akzeptanz und politische Unterstützung |
| 8. Breite Partizipation am lokalen CTC-Prozess | Vielfältige Beteiligung verschiedener Akteursgruppen | Ermöglicht multiperspektivische Herangehensweise und breitere Verankerung |
Die drei wichtigsten Faktoren im Detail
Ausreichende Ressourcen für die CTC-Koordination
Die CTC-EFF-Studie zeigt deutlich: Eine ausreichend ausgestattete Koordinierungsstelle ist entscheidend für den Erfolg. Die Daten belegen, dass die Kapazitäten und Kompetenzen der Koordination einen direkten positiven Einfluss auf die Vermeidung von Konflikten im Gebietsteam und die Qualität der Implementation haben.
Eine der häufigsten Herausforderungen in der Praxis ist die unzureichende personelle Ausstattung der CTC-Koordination. Viele Kommunen versuchen, die Aufgaben mit einem Stellenanteil von weniger als 50% zu bewältigen, was sich als kontraproduktiv erwiesen hat. Die Koordinationsstelle fungiert als zentrale Schnittstelle zwischen den verschiedenen Akteuren, organisiert den Gesamtprozess und hält die Kommunikationsfäden zusammen. All dies erfordert ausreichend Zeit und kontinuierliches Engagement.
Für eine nachhaltige Finanzierung der Koordinationsstelle haben sich verschiedene Modelle bewährt:
- Kooperation mit gesetzlichen Krankenkassen (wie in Braunschweig durch die Techniker Krankenkasse)
- Anbindung an bestehende Strukturen wie Gesundheits- oder Jugendämter
- Bei kreisangehörigen Kommunen: Unterstützung durch den Landkreis
- Kombination verschiedener Fördertöpfe (kommunale Mittel, Projektförderung, Stiftungsgelder)
Überall dort, wo die Koordination mit ausreichenden Ressourcen ausgestattet war, zeigte sich eine deutlich höhere Implementationsqualität und bessere Ergebnisse in der Präventionsarbeit.
Breite Partizipation am lokalen CTC-Prozess
Fast die Hälfte der befragten CTC-Gebietsteams bewertet den Einbezug verschiedener Personengruppen als unzureichend. Besonders gering ist die Beteiligung von Eltern, Freizeitanbietern, Medienvertretern und Ehrenamtlichen – dabei ist gerade diese Vielfalt entscheidend für den langfristigen Erfolg.
Ein typisches Fallbeispiel: In mehreren Kommunen wollten die Koordinierenden zunächst mit einem kleinen Kreis starten und das Team erst nach der Schülerbefragung erweitern. Diese Strategie erwies sich jedoch als hinderlich, da für die erfolgreiche Durchführung der Befragung bereits ein breiteres Netzwerk hilfreich gewesen wäre. Die ursprüngliche Annahme, dass erst auf Basis der Befragungsergebnisse weitere Partner gewonnen werden könnten, verkehrte sich ins Gegenteil: Ohne breite Beteiligung war es schwieriger, die Befragung umfassend durchzuführen.
Die Vielfalt an beteiligten Akteuren bringt entscheidende Vorteile:
- Unterschiedliche fachliche Perspektiven auf das Thema Prävention
- Zugang zu verschiedenen Zielgruppen und Settings
- Breiteres Spektrum an Ressourcen und Kompetenzen
- Höhere Legitimität in der Kommune
- Bessere Verankerung des Präventionsansatzes
Eine effektive Strategie zur Gewinnung verschiedener Akteure ist es, zu Beginn gezielt persönliche Gespräche mit Schlüsselpersonen aus verschiedenen Bereichen zu führen, bei denen nicht nur der CTC-Ansatz vorgestellt, sondern auch der potenzielle Mehrwert für die jeweilige Institution herausgearbeitet wird. So gelingt es, ein interdisziplinäres Team aufzubauen, das von Anfang an die Bereiche Schule, Jugendarbeit, Gesundheit, Polizei, Stadtplanung und Elternvertretung umfasst.
Effektive Kommunikation im CTC-Gebietsteam
Die Kommunikationsqualität im Team hat sich als kritischer Erfolgsfaktor herauskristallisiert. Rund die Hälfte der Kommunen bewertet ihre aktuelle Kommunikation als unzureichend – mit negativen Auswirkungen auf Teamgeist, Konflikthäufigkeit und letztlich die Implementationsqualität.
Erfolgreiche Kommunikationsstrategien in CTC-Kommunen zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:
- Feste Terminstruktur mit ausreichender Planungssicherheit
- Klare Rollenverteilung und Verantwortlichkeiten innerhalb des Teams
- Transparente Dokumentation von Entscheidungen und nächsten Schritten
- Nutzung verschiedener Kommunikationskanäle (Präsenz, digital, hybrid)
- Wertschätzende Kommunikationskultur, die unterschiedliche Perspektiven respektiert
Besonders gut funktioniert ein hybrides Kommunikationsmodell: monatliche Präsenztreffen für die strategische Arbeit, ergänzt durch digitale Zwischenformate für Updates und Abstimmungen. Eine gemeinsame digitale Plattform, auf der alle relevanten Dokumente, Protokolle und Materialien abgelegt werden, unterstützt die Transparenz und erleichtert neuen Teammitgliedern den Einstieg.
Priorisierungshilfe: Womit beginnen?
Angesichts der acht Schlüsselfaktoren stellt sich die Frage: Wo anfangen? Die Forschungsergebnisse liefern hier eine klare Orientierung für die Priorisierung.
Die folgende Tabelle liefert eine Entscheidungshilfe, welche Faktoren je nach Phase Ihrer CTC-Implementation priorisiert werden sollten:
| CTC-Phase | Prioritäre Schlüsselfaktoren | Begründung |
|---|---|---|
| Vor dem Start / Planungsphase | 1. Ausreichende Ressourcen für die Koordination 2. Unterstützung durch die CTC-Transferstellen |
Diese beiden Faktoren bilden das Fundament für alle weiteren Aktivitäten. Ohne ausreichende Koordinationskapazität ist der Erfolg unwahrscheinlich. |
| Phase 1: Mobilisierung | 3. Breite Partizipation 4. Wirksame Öffentlichkeitsarbeit |
In dieser Phase geht es um die Gewinnung der erforderlichen Akteure und die Schaffung von Bewusstsein für den Bedarf an Prävention. |
| Phase 2: Organisierung | 5. Effektive Kommunikation im Team 6. Systematische Integration neuer Mitglieder |
Hier steht der Aufbau funktionierender Arbeitsstrukturen im Mittelpunkt. Gute Kommunikation im Team ist der Schlüssel zum Erfolg. |
| Phase 3: Profilerstellung | 7. Fundiertes CTC-spezifisches Präventionswissen | Für die Analyse und Interpretation der Daten ist ein tiefgreifendes Verständnis der theoretischen Grundlagen unerlässlich. |
| Phase 4 & 5: Aktionsplanung und Umsetzung | 8. Positive Haltung und Motivation der Beteiligten | In den späteren Phasen wird die Aufrechterhaltung der Motivation immer wichtiger, insbesondere wenn erste Hürden zu überwinden sind. |
Hinweis: Diese Priorisierung ist als Orientierungshilfe zu verstehen. Je nach lokalen Gegebenheiten können auch andere Schwerpunktsetzungen sinnvoll sein. Allen Faktoren ist jedoch gemeinsam, dass sie nicht isoliert betrachtet werden sollten – sie beeinflussen sich gegenseitig und entfalten in ihrer Gesamtheit die größte Wirkung.
Selbstcheck für Kommunen: Wo stehen wir?
Nutzen Sie den folgenden interaktiven Selbstcheck, um den aktuellen Stand Ihrer CTC-Implementation zu bewerten. Beantworten Sie jede Frage mit dem entsprechenden Format und erhalten Sie sofort eine Einschätzung Ihrer Situation.
CTC-Selbsteinschätzung
CTC Selbstcheck-Tool
Bewerten Sie den aktuellen Stand Ihrer CTC-Implementation anhand der folgenden Kriterien.
Ressourcen und strukturelle Verankerung
Partizipation und Teamzusammensetzung
Kommunikation und Zusammenarbeit
Fachliche Kompetenz und Unterstützung
Öffentlichkeitsarbeit und lokale Einbettung
Ihre Gesamtpunktzahl: 45/75
Auswertung: Gute Umsetzung mit einzelnen Verbesserungspotentialen
Empfehlungen basierend auf Ihrer Bewertung:
Basierend auf Ihrer aktuellen Bewertung sollten Sie besonders auf die Bereiche achten, die unterdurchschnittlich bewertet wurden (1-2 Punkte). Priorisieren Sie diese Bereiche für Ihre nächsten Verbesserungsschritte.
Hinweis: Dieser Selbstcheck kann als Ausgangspunkt für eine vertiefte Auseinandersetzung mit den einzelnen Faktoren dienen. Bei identifizierten Schwachstellen lohnt es sich, gezielt Verbesserungsmaßnahmen zu ergreifen und diese bei einer späteren Wiederholung des Checks zu evaluieren.
Quellenhinweis: Die Selbsteinschätzung und die Schlüsselfaktoren basieren auf den Handlungsempfehlungen für die Implementation von Communities That Care von Walter et al. (2025).
Fazit: Der Blick nach vorn
Die erfolgreiche Implementation von Communities That Care ist kein Selbstläufer, sondern bedarf einer systematischen Beachtung der acht identifizierten Schlüsselfaktoren. Die gute Nachricht: Mit den hier vorgestellten konkreten Handlungsempfehlungen können Kommunen ihre CTC-Arbeit gezielt verbessern.
Die Forschungsergebnisse der CTC-EFF-Studie bieten erstmals für Deutschland eine solide Evidenzbasis für die Wirksamkeit des Ansatzes – vorausgesetzt, die Implementation erfolgt in guter Qualität. Besonders ermutigend: Selbst unter den erschwerten Bedingungen der COVID-19-Pandemie konnten positive Effekte nachgewiesen werden.
Für Kommunen, die CTC einführen oder weiterentwickeln möchten, lohnt sich der Blick auf bestehende Erfolgsbeispiele und der regelmäßige Austausch mit anderen CTC-Standorten. Die Nationale CTC-Transferstelle bietet hierfür vielfältige Unterstützungsmöglichkeiten.
Mit einer strategischen Herangehensweise und der konsequenten Beachtung der Schlüsselfaktoren kann CTC zu einem kraftvollen Instrument werden, um die psychosoziale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Ihrer Kommune nachhaltig zu fördern.
Literatur
Birgel, V., Röding, D., Reder, M., Soellner, R., & Walter, U. (2023). Contextual effects of community capacity as a predictor for adolescent alcohol, tobacco, and illicit drug use: A multi-level analysis. SSM-Population Health, 24, Article 101521. https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2023.101521
Birgel, V., Walter, U., & Röding, D. (2023). Relating community capacity to the adoption of an evidence-based prevention strategy: A community-level analysis. Journal of Public Health. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s10389-023-02159-x
Röding, D., Reder, M., Soellner, R., Birgel, V., Stolz, M., Groeger-Roth, F., & Walter, U. (2023). Evaluation des wissenschaftsbasierten kommunalen Präventionssystems Communities That Care: Studiendesign und Baseline-Äquivalenz intermediärer Outcomes. Prävention und Gesundheitsförderung, 18(3), 316-326. https://doi.org/10.1007/s11553-022-00972-y
Röding, D., von Holt, I., Decker, L., & Walter, U. (2025). Early Effects of Communities That Care on System Change Outcomes: A Quasi-Experimental Study. BMC Public Health. Advance online publication. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-5685486/v1
Walter, U., Röding, D., Ünlü, S., Decker, L., & von Holt, I. (2025). Handlungsempfehlungen für die Implementation von Communities That Care. Medizinische Hochschule Hannover. https://wegweiser-gruene-liste.de/fileadmin/user_upload/wwgl/PDFs/CTC-Handlungsempfehlungen.pdf
Das könnte Sie auch interessieren…