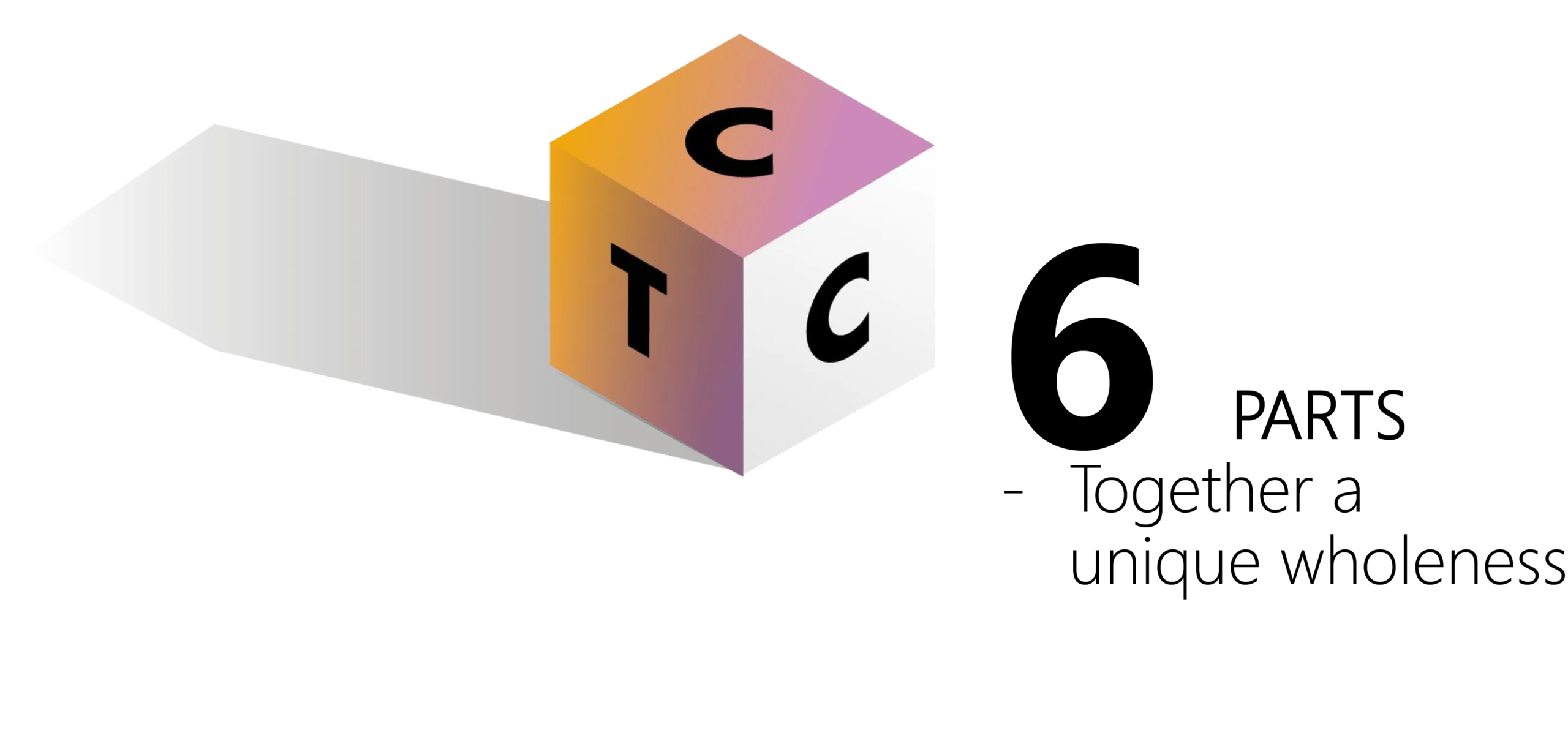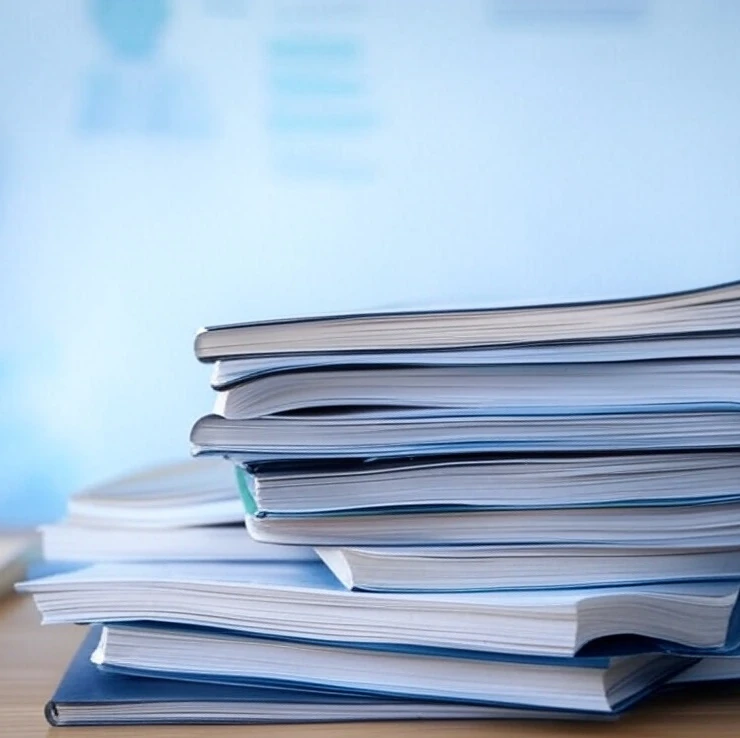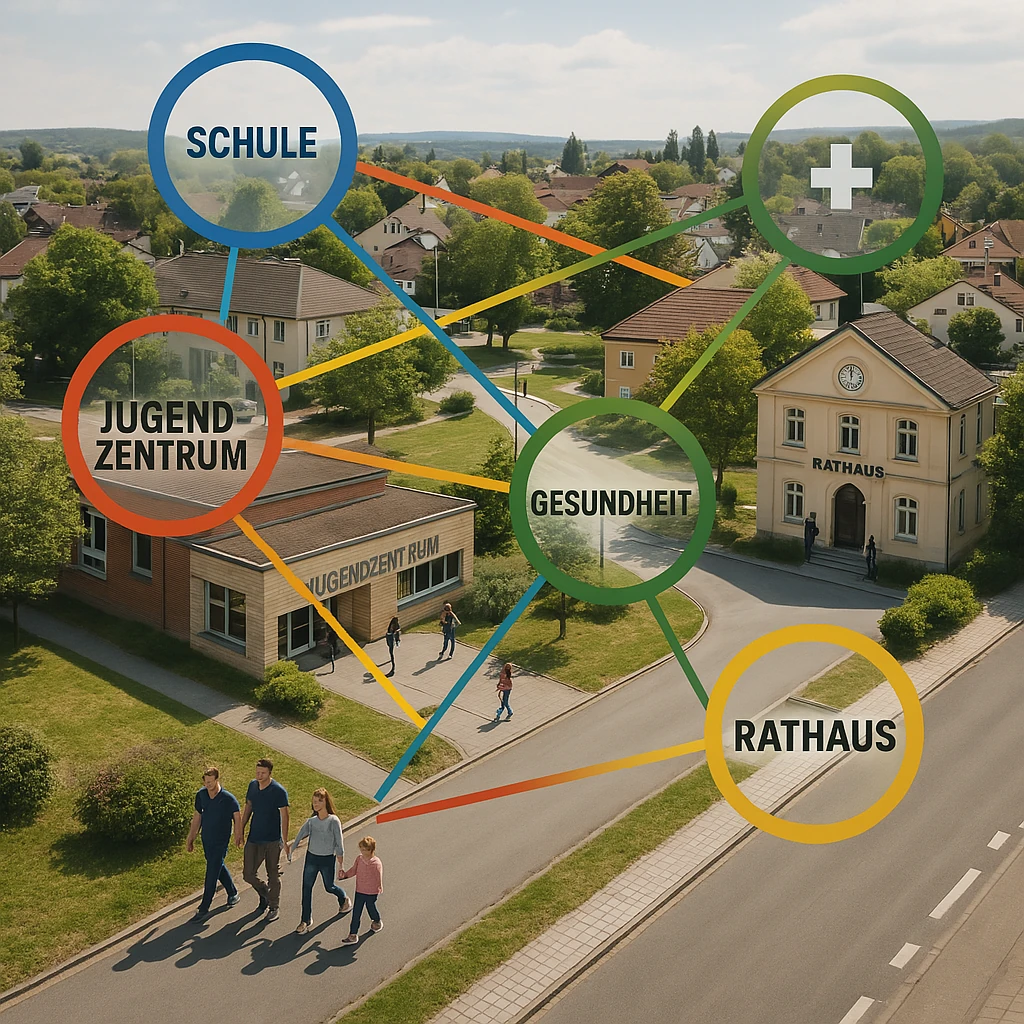75% weniger Jugendgewalt durch CTC: Was deutsche Kommunen von der Denver-Evaluation lernen können
Eine aktuelle Studie aus Denver, Colorado, liefert neue empirische Evidenz zur Wirksamkeit von Communities That Care (CTC) in der Jugendgewaltprävention. Die Studie von Kingston und Kollegen (2025) vertieft zudem das Verständnis über die Gelingensvoraussetzungen – Erkenntnisse, die für die Anwendung des Ansatzes in deutschen Kommunen wertvoll sind. Die Evaluation zeichnet sich durch ihre methodische Qualität und den langen Untersuchungszeitraum aus.
Die Studie im Detail: Design und Methodik
Studiendesign und Untersuchungsgebiete
Die Studie untersuchte zwei von Gewalt betroffene Stadtteile in Denver mit hohen Gewaltraten und sozioökonomischer Benachteiligung:
- Stadtteil A: Größeres Gebiet mit etwa 11% Familien unterhalb der Armutsgrenze.
- Stadtteil B: Kleineres Gebiet mit 19% Familien in Armut.
Beide Stadtteile wiesen zu Studienbeginn Jugendarrestraten auf, die deutlich über dem nationalen US-Durchschnitt lagen – eine Ausgangslage, die mit sozial benachteiligten Quartieren in deutschen Großstädten vergleichbar ist.
Innovative Methodologie
Die Forscher verwendeten zwei quasi-experimentelle Ansätze, die auch für deutsche Evaluationsstudien relevant sind:
1. Interrupted Time Series (ITS) – Unterbrochene Zeitreihenanalyse
Diese Methode vergleicht Trends vor und nach der Intervention innerhalb desselben Stadtteils. Sie beantwortet die Frage: „Veränderte sich der Verlauf der Jugendgewalt nach Beginn der CTC-Implementation signifikant?“
Die ITS-Analyse zeigte:
- In Stadtteil A: Keine signifikante Veränderung der bereits niedrigen Trends
- In Stadtteil B: Signifikante Trendumkehr von steigenden zu fallenden Arrestraten
2. Difference in Differences (DiD) mit synthetischen Kontrollen
Diese Methode konstruiert eine „synthetische Kontrollgemeinde“ aus den Daten aller anderen Denver-Stadtteile, die Stadtteil B in relevanten Merkmalen ähneln. Dies adressiert ein häufiges Problem in der Präventionsforschung: das Fehlen geeigneter Kontrollgruppen. Die DiD-Analyse bestätigte, dass die Reduktion in Stadtteil B signifikant größer war als in vergleichbaren Gebieten ohne CTC.
Primäres Outcome: Youth Arrests for Violent Offenses
Als Hauptindikator verwendete die Studie „youth arrests for violent offenses“ (Jugendarreste für Gewaltdelikte) bei 10- bis 24-Jährigen. Diese umfassten:
- Mord und fahrlässige Tötung
- Raub
- Schwere Körperverletzung
- Vergewaltigung
Für den deutschen Kontext ist wichtig zu verstehen, dass „arrests“ (Festnahmen/Verhaftungen) im US-System anders funktionieren als in Deutschland. Vergleichbare deutsche Indikatoren wären:
- Polizeilich registrierte Gewalttaten von Jugendlichen
- Tatverdächtigenzahlen aus der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS)
- Verurteilungen nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG)
Die Intervention: Modifiziertes CTC mit Fokus auf Gemeindeebene
Theoretische Grundlagen: Social Development Model
Das der Studie zugrundeliegende „Social Development Model“ (Modell der sozialen Entwicklung) postuliert, dass Jugendliche durch drei Elemente an prosoziale Bezugspersonen und Institutionen gebunden werden:
- Gelegenheiten zur prosozialen Beteiligung
- Fähigkeiten diese Gelegenheiten erfolgreich wahrzunehmen
- Anerkennung für die prosoziale Mitwirkung
Diese Bindungen fördern die Übernahme prosozialer Normen und reduzieren Problemverhalten.
Die implementierten Strategien im Detail
1. Power of One (PO1) Media Campaign
Eine jugendgeleitete Medienkampagne mit digitaler Werbung, öffentlichen Events und Social-Media-Inhalten. Ziel: Stärkung der „neighborhood attachment“ (Nachbarschaftsbindung).
2. Social Development Strategy (SDS)
Ein systematischer Ansatz zur Einbettung der drei Kernelemente (Gelegenheiten, Fähigkeiten, Anerkennung) in alle Programmaktivitäten.
3. Violence, Injury Protection and Risk Screen (VIPRS)
Ein Screening-Tool für Kinderärzte zur Früherkennung von Jugendlichen mit erhöhtem Gewaltrisiko. Ähnliche Ansätze finden sich in deutschen Frühen Hilfen und der Zusammenarbeit zwischen Gesundheitswesen und Jugendhilfe.
4. Mini-Grants für lokale Initiativen (nur Stadtteil A)
Kleine Fördersummen (durchschnittlich 2.095 USD) für lokale Organisationen zur Durchführung jugendorientierter Aktivitäten.
5. PATHS/Sozial-emotionales Lernen im Sozialraum (nur Stadtteil B)
„Promoting Alternative Thinking Strategies“ – ein sozial-emotionales Lernprogramm, das über Schulen hinaus im gesamten Stadtteil implementiert wurde. PATHS (in Deutschland DENK – WEGE) ist auch in der deutschen Grünen Liste Prävention gelistet.
Zentrale Ergebnisse: Was die Zahlen bedeuten
Der Mobilisierungseffekt in Stadtteil B
Ein zentrales Ergebnis war der Rückgang der Arrestraten in Stadtteil B von 1.086 pro 100.000 Jugendliche (2016) auf 443 (2017) – eine Reduktion um 59% bereits im ersten Jahr. Dieser „Mobilisierungseffekt“ deutet darauf hin, dass bereits die intensive Vorbereitung und Gemeindemobilisierung präventive Wirkung entfalten kann.
Langzeiteffekte und Nachhaltigkeit
Bis 2021 sanken die Raten in Stadtteil B weiter auf 276 pro 100.000 – eine Gesamtreduktion von 75%. Die Persistenz dieser Effekte über fünf Jahre und während der Pandemie zeigt die Nachhaltigkeit der Intervention und widerspricht Kritik an nur kurzfristigen Präventionserfolgen.
Stadtteil A: Wenn Stabilität ein Erfolg ist
Stadtteil A zeigte keine signifikanten Veränderungen, hatte aber bereits niedrige Ausgangswerte (durchschnittlich 312 pro 100.000) aufgrund einer vorherigen CTC-Teilnahme (2011-2016). Die Stabilität dieser Raten während der Pandemie – als viele US-Städte Gewaltanstiege verzeichneten – kann als Präventionserfolg interpretiert werden.
Erfolgsfaktoren und Hindernisse: Lehren für die Praxis
Die unterschiedlichen Ergebnisse in den beiden Stadtteilen bieten wichtige Einblicke in die Bedingungen erfolgreicher Präventionsarbeit. Der zentrale Unterschied zwischen beiden Gebieten lag in ihrer Größe und den daraus resultierenden Implementationsbedingungen. Stadtteil B, mit etwa einem Viertel der Einwohnerzahl von Stadtteil A, ermöglichte eine intensivere Durchdringung der Präventionsmaßnahmen und persönlichere Vernetzung der Akteure. Diese überschaubare Größe erwies sich als entscheidender Vorteil für die erfolgreiche Mobilisierung und nachhaltige Verankerung des CTC-Systems.
Ein weiterer kritischer Erfolgsfaktor in Stadtteil B war der durch vorangegangene Gewaltereignisse entstandene Handlungsdruck. Diese Krisenerfahrung führte zu einer außergewöhnlich hohen Mobilisierung und dem gemeinsamen Willen zur Veränderung. Kombiniert mit einer klaren Führungsstruktur und engagierten lokalen Schlüsselpersonen („local champions“) entstand ein fokussiertes Implementationsumfeld ohne konkurrierende Initiativen, das die volle Konzentration auf CTC ermöglichte.
Stadtteil A hingegen stand vor strukturellen Herausforderungen, die trotz vorheriger CTC-Erfahrung die erneute Mobilisierung erschwerten. Die schiere Größe des Gebiets machte eine flächendeckende Umsetzung komplex und ressourcenintensiv. Erschwerend kam hinzu, dass multiple Präventionsinitiativen um Aufmerksamkeit und Ressourcen konkurrierten, was zu Duplikationen und unklaren Zuständigkeiten führte. Gleichzeitig destabilisierten rapide soziale Veränderungen durch Gentrifizierung die gewachsenen Netzwerkstrukturen. Nach Jahren kontinuierlicher Programmteilnahme zeigte sich zudem eine gewisse „Präventionsmüdigkeit“ bei wichtigen Akteuren, die das erneute Engagement für CTC dämpfte.
Übertragung auf Deutschland: Was können wir lernen?
Methodische Implikationen
Die Studie zeigt, dass methodisch hochwertige Wirkungsevaluation auch ohne randomisierte Kontrollgruppen möglich ist. Die Methoden der synthetischen Kontrollen und unterbrochenen Zeitreihen bieten praktikable Alternativen zu randomisiert-kontrollierten Studiendesigns, die auf gemeindeebene nur mit hohem Aufwand durchführbar sind.
Bedeutung der Mobilisierungsphase
Der frühe Effekt in Stadtteil B zeigt die Relevanz intensiver Vorbereitung. Deutsche CTC-Kommunen sollten:
- Mindestens 6-12 Monate für die Mobilisierung einplanen
- Breite Beteiligung vor Programmstart sicherstellen
- Die Mobilisierung selbst als Intervention verstehen
Anpassung an lokale Gegebenheiten
Die unterschiedlichen Ergebnisse zeigen: CTC muss an die lokalen Gegebenheiten angepasst werden. Empfehlungen:
- In Großstädten: Fokus auf überschaubare Stadtteile/Sozialräume
- Mehr Ressourcen für Koordination in größeren Gebieten
- Flexible Implementationsmodelle je nach Kontext
Fazit: Was die Denver-Studie für die deutsche Präventionslandschaft bedeutet
Die Evaluation von Kingston et al. (2025) liefert empirische Evidenz für die Wirksamkeit von CTC in der Jugendgewaltprävention. Die 75%ige Reduktion der Gewaltraten in Stadtteil B über fünf Jahre ist ein ermutigendes Ergebnis, das die Bedeutung systematischer, kommunaler Prävention unterstreicht.
Für Deutschland ergeben sich aus der Studie mehrere relevante Erkenntnisse:
- Wissenschaftsbasierte Ansätze sind praktikabel und wirksam – wenn sie an lokale Kontexte angepasst werden
- Mobilisierung ist zentral – der Prozess ist ebenso wichtig wie die Programme
- Größe des Gebiets ist relevant – Implementationsstrategien müssen zur Gebietsgröße passen
- Nachhaltigkeit ist möglich – erfordert aber kontinuierliche Unterstützung
Literatur
Kingston, B. E., Mattson, S. A., Little, J. S., Steeger, C. M., Sigel, E. J., Carrillo, U. L., Bechhoefer, D., Argamaso, S., & D’Inverno, A. (2025). Effects of the Communities that Care (CTC) Prevention System on Youth Violence Outcomes in Two Violence-Impacted Denver Communities. American Journal of Criminal Justice. https://doi.org/10.1007/s12103-025-09811-0
Das könnte Sie auch interessieren…