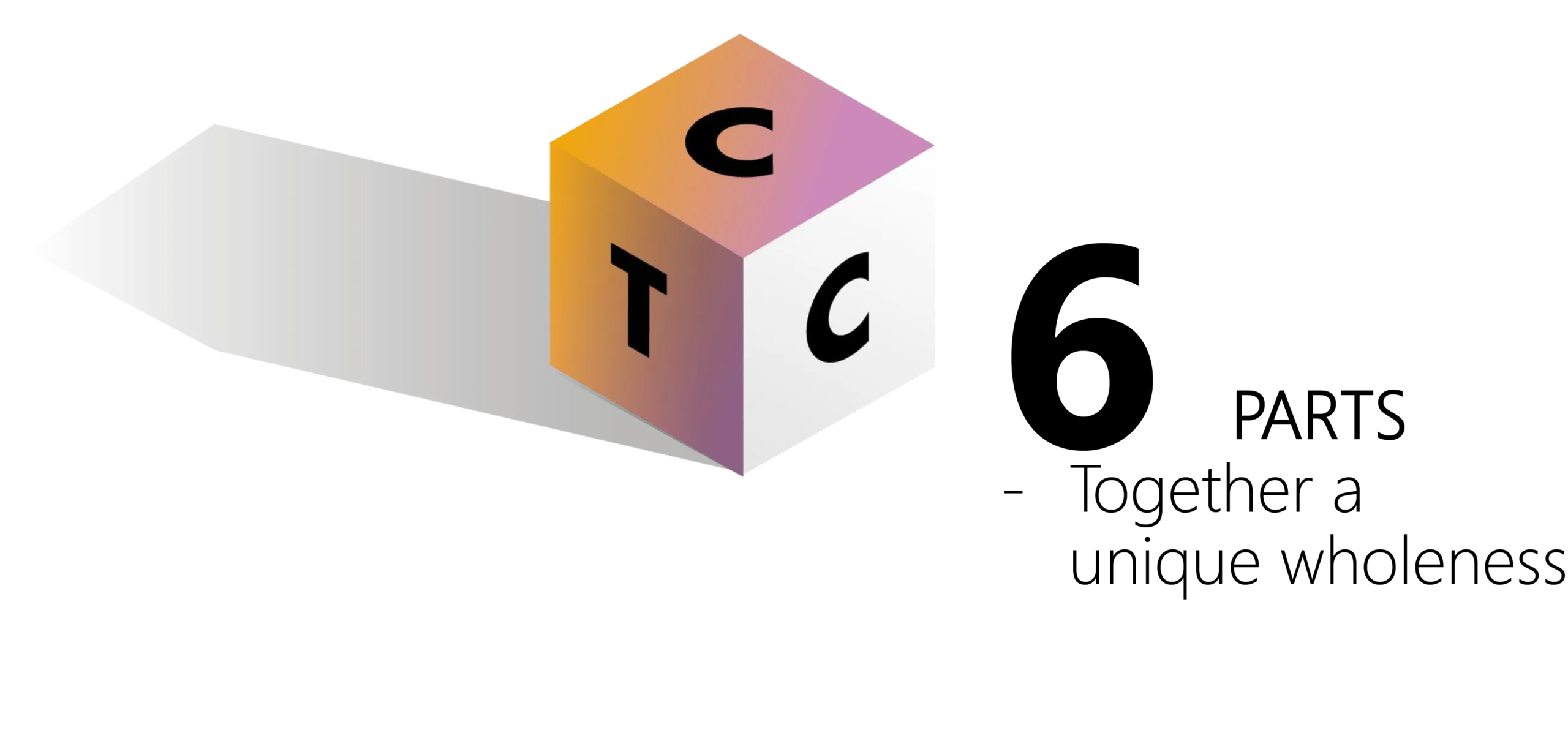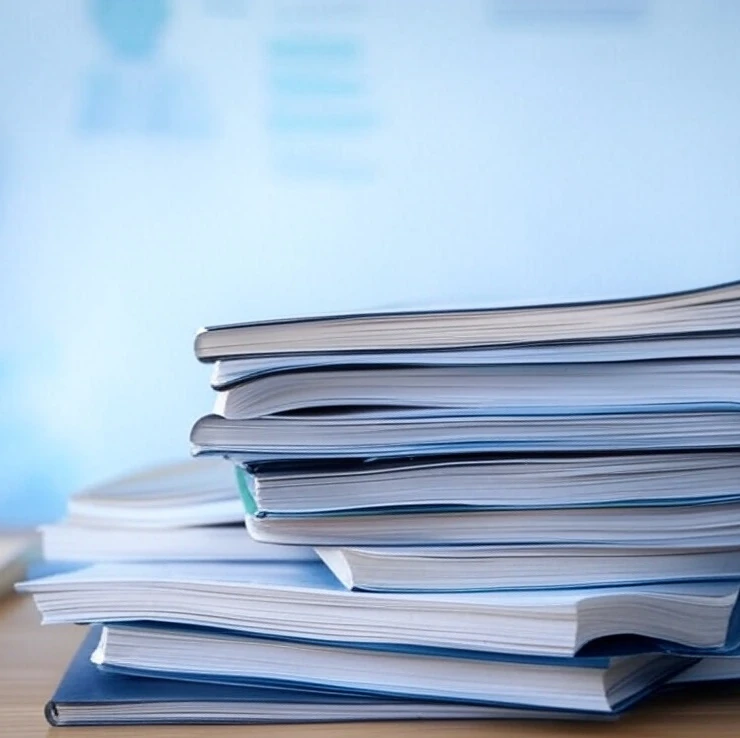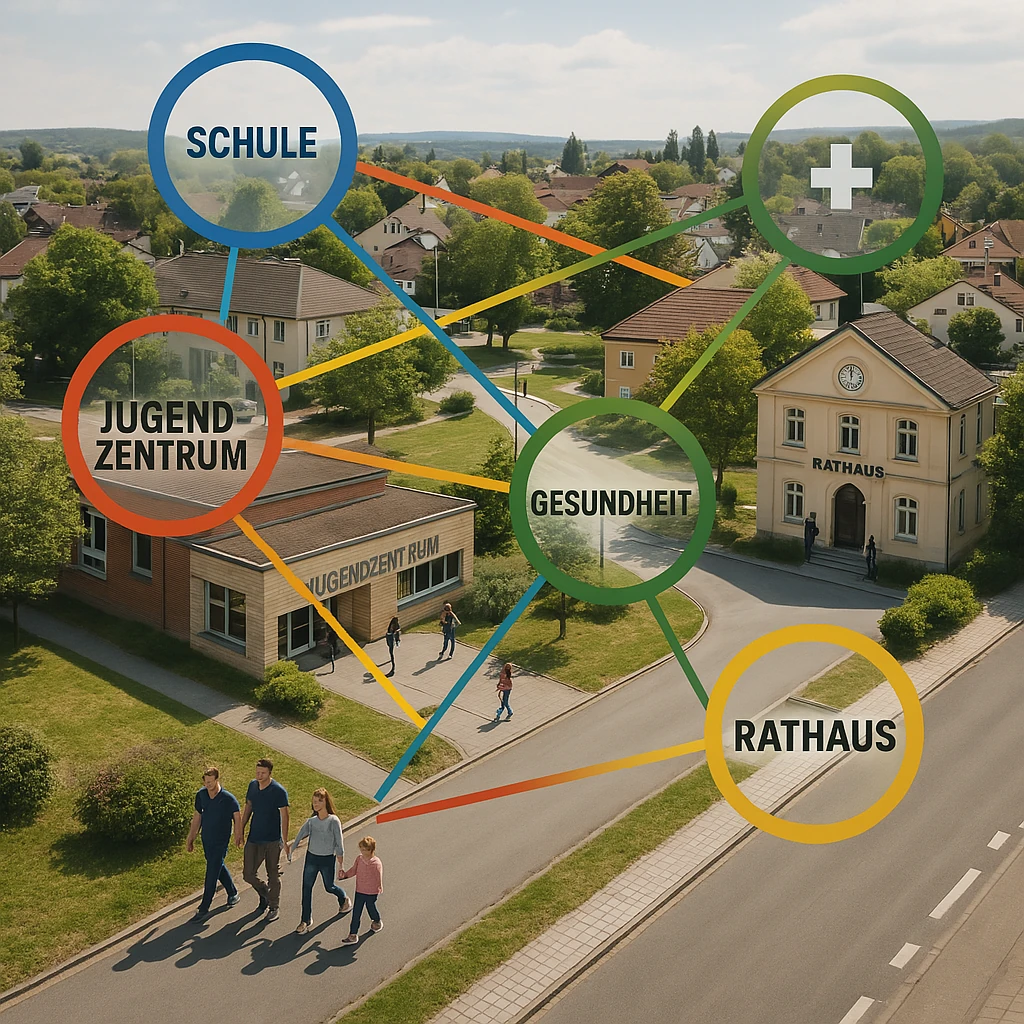Interviewer: Herzlich willkommen, Herr Groeger-Roth. Sie sind beim Landespräventionsrat Niedersachsen tätig und gelten als jemand, der das Präventionskonzept „Communities That Care“ maßgeblich nach Deutschland, insbesondere nach Niedersachsen, gebracht hat. Was hat Sie dazu bewogen, nach neuen Wegen in der Präventionsarbeit zu suchen?
Frederick Groeger-Roth: Vielen Dank für die Einladung. Ja, bei meiner Arbeit im Landespräventionsrat, der ja eine Einrichtung der Landesregierung ist und die Aufgabe hat, Prävention in Niedersachsen zu stärken und zu koordinieren, fiel uns – und mir auch persönlich durch meine frühere Beschäftigung mit stadtsoziologischen Fragen – immer wieder auf: Es wird unglaublich viel Gutes und Wichtiges in den Kommunen für Kinder und Jugendliche getan. Das Engagement ist riesig. Aber oft laufen die vielen Aktivitäten unkoordiniert nebeneinanderher. Ressourcen werden vielleicht nicht optimal genutzt, und die Frage blieb oft offen: Kommt das, was wir tun, auch wirklich bei den Kindern und Jugendlichen an und bewirkt es etwas Positives? Wir sahen, dass bestimmte Probleme sich in manchen Stadtteilen häuften, und fragten uns, wie wir Prävention zielgerichteter und damit wirksamer gestalten können.
Interviewer: Das klingt nach einer großen Herausforderung. Was macht denn „Communities That Care“, kurz CTC, anders als die bisherigen Ansätze?
Frederick Groeger-Roth: Der entscheidende Unterschied ist der strukturierte, datengestützte Ansatz. CTC ist keine einzelne Maßnahme, sondern eine umfassende Strategie für eine Kommune oder einen Stadtteil. Anstatt aus dem Bauch heraus oder basierend auf Einzelmeinungen zu handeln, schauen wir uns systematisch an: Was sind denn tatsächlich die spezifischen Bedarfe der Kinder und Jugendlichen vor Ort? Wo liegen besondere Risiken, aber – ganz wichtig – wo liegen auch die Stärken und Schutzfaktoren, auf denen wir aufbauen können? Dieser Blick auf die lokalen Gegebenheiten ist zentral.
Interviewer: Wie funktioniert dieser Prozess konkret? Wie ermittelt man diese Bedarfe und Schutzfaktoren?
Frederick Groeger-Roth: Das Herzstück ist eine wissenschaftlich fundierte, standardisierte Befragung der Kinder und Jugendlichen selbst, meist im Alter von 12 bis 17 Jahren. Sie sagen uns anonym, wie sie ihre Familie, ihre Schule, ihre Freunde und ihre Nachbarschaft erleben. Daraus gewinnen wir ein sehr genaues Bild über die Verbreitung von Verhaltensproblemen, aber eben auch über die zugrundeliegenden Risiko- und Schutzfaktoren. Diese Daten bilden die Grundlage für alle weiteren Schritte. Wir führen das in Niedersachsen seit 2013 übrigens alle zwei Jahre landesweit durch, in Kooperation mit der Universität Hildesheim.
Interviewer: Das heißt, die Jugendlichen selbst liefern die Datenbasis. Und was passiert dann mit diesen Erkenntnissen?
Frederick Groeger-Roth: Genau. Die lokalen Akteure – aus Schulen, Jugendhilfe, Vereinen, Verwaltung, Polizei etc. – setzen sich zusammen, analysieren diese Daten und auch die bereits vorhandenen Präventionsangebote. Sie identifizieren gemeinsam, wo die größten lokalen Bedarfe liegen – also welche Risiko- und Schutzfaktoren sie vorrangig angehen wollen. Das schafft eine gemeinsame Basis und verhindert, dass jeder nur seinen eigenen Bereich sieht.
Interviewer: Es gibt ja unzählige Präventionsprogramme auf dem Markt. Wie stellt CTC sicher, dass dann auch wirklich effektive Maßnahmen ausgewählt werden?
Frederick Groeger-Roth: Das ist ein weiterer Kernpunkt. CTC setzt konsequent auf evidenzbasierte Prävention. Das heißt, es werden Programme ausgewählt, deren Wirksamkeit in wissenschaftlichen Studien nachgewiesen wurde. Um den Kommunen die Auswahl zu erleichtern, haben wir die „Grüne Liste Prävention“ entwickelt – eine Online-Datenbank, die man sich wie eine Art Stiftung Warentest für Präventionsprogramme vorstellen kann. Dort werden Programme nach der Belastbarkeit ihres Wirksamkeitsnachweises bewertet. Die Kommune kann dann gezielt nach Programmen suchen, die zu den priorisierten Risiko- und Schutzfaktoren und zur Zielgruppe passen.
Interviewer: Dieser ganze Prozess – Datenerhebung, Analyse, Programmauswahl, Koordination – klingt sehr durchdacht, aber auch nach einem erheblichen Aufwand für die Kommunen. Lohnt sich das?
Frederick Groeger-Roth: Der Aufwand ist da, keine Frage. Aber er lohnt sich, weil er dazu führt, dass Ressourcen gezielter und damit effektiver eingesetzt werden. Die Zusammenarbeit und Abstimmung der Akteure verbessert sich deutlich. Internationale Studien, vor allem aus den USA, wo CTC entwickelt wurde, zeigen beeindruckende Ergebnisse: Kommunen, die mit CTC arbeiten, nutzen häufiger evaluierte Programme, die Qualität der Umsetzung ist besser, und – das ist das Entscheidende – das Problemverhalten bei Jugendlichen geht messbar zurück, teilweise um 25 bis 30 Prozent im Vergleich zu Kommunen ohne CTC. Auch unsere eigenen Erfahrungen und Prozessevaluationen in Niedersachsen zeigen, dass die Akteure CTC als sehr hilfreiches Instrument sehen, um ihre Arbeit besser zu strukturieren und auszurichten. Wenn man den Prozess einmal durchlaufen hat, wird der Aufwand übrigens auch geringer.
Interviewer: Das sind überzeugende Argumente. Gibt es denn auch Bestrebungen, diese Wirksamkeitsnachweise für Deutschland zu erbringen?
Frederick Groeger-Roth: Ja, absolut. Wir sind sehr froh, dass wir eine bundesweite Wirksamkeitsstudie mit Förderung durch das Bundesforschungsministerium durchführen konnten. Hier haben wir eng mit der Medizinischen Hochschule Hannover, der Universität Hildesheim und dem Deutschen Präventionstag zusammengearbeitet. Über mehrere Jahre verglichen wir CTC-Kommunen mit ähnlichen Kommunen, die CTC nicht anwenden, um genau diese Effekte auch unter deutschen Bedingungen wissenschaftlich abzusichern. Das ist uns sehr wichtig, denn letztlich geht es darum, dass Prävention tatsächlich bei den Kindern und Jugendlichen ankommt und ihr Aufwachsen positiv beeinflusst.
Interviewer: Herr Groeger-Roth, vielen Dank für diese spannenden Einblicke in Communities That Care und Ihre Arbeit beim Landespräventionsrat Niedersachsen.
Frederick Groeger-Roth: Sehr gerne.
Das könnte Sie auch interessieren…